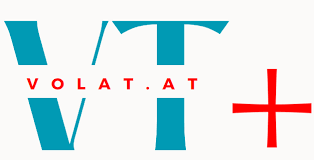[ad_1]
Die Weltwirtschaft verlangsamt sich, ist aber nicht zum Stillstand gekommen – trotz Corona-Pandemie, Krieg in der Ukraine, rissigen Lieferketten und hoher Inflation. Das ist die zentrale Botschaft des Internationalen Währungsfonds (IWF) im aktuellen Bericht zur Weltwirtschaft. Dennoch scheint eine vollständige Erholung in Richtung der Trends vor der Pandemie „zunehmend außer Reichweite“ zu sein.
In den zwei Jahrzehnten vor der Pandemie betrug das globale Wirtschaftswachstum durchschnittlich 3,8 Prozent pro Jahr. Für dieses Jahr erwartet der IWF nun unverändert zur Juli-Prognose 3 Prozent und für 2024 2,9 Prozent – 0,1 Prozentpunkte weniger als im Juli. Auch die Inflation ist rückläufig, so dass sich die Anzeichen einer „sanften Landung“ der Wirtschaft nach der Phase der Hochinflation, also einer Preisstabilisierung ohne großen Wirtschaftsabschwung, mehren. Dies gilt insbesondere für die USA, doch die Erholung in China gestaltet sich spürbar schwierig.
Für Österreich geht der IWF in diesem Jahr weiterhin von einem leichten Plus von 0,1 Prozent aus, während die heimischen Prognostiker von Wifo und IHS zuletzt einen Konjunkturrückgang von 0,8 bis 0,4 Prozent prognostizierten. Der IWF prognostiziert für 2024 ein Wachstum von 0,8 Prozent, etwas weniger als Wifo (1,2 Prozent) und IHS (0,9 Prozent). Der IWF geht davon aus, dass die Inflation in diesem Jahr 7,8 Prozent und im Jahr 2024 3,7 Prozent betragen wird. Der Unterschied zur jüngsten Prognose von Wifo und IHS ist daher nur gering.
Weltweit sieht der IWF drei Trends. Der Dienstleistungssektor hat sich fast vollständig erholt. Im Jahr 2024 wird mit einem langsameren Wachstum gerechnet, was die Inflation und den Druck auf den Arbeitsmarkt dämpfen dürfte. Vor allem in Ländern mit einem höheren Anteil an variabel verzinslichen Krediten macht sich die Straffung der Geldpolitik bemerkbar. Schließlich haben Länder, die stark auf russische Energieimporte angewiesen sind, größere Energiepreissteigerungen und stärkere Konjunkturabschwächungen erlebt.
Die Weitergabe der hohen Energiepreise hat die Kerninflation im Euroraum in die Höhe getrieben. Doch bisher gibt es kaum Anzeichen für eine „Lohn-Preis-Spirale“ und die Reallöhne bleiben unter dem Niveau vor der Corona-Krise.
[ad_2]