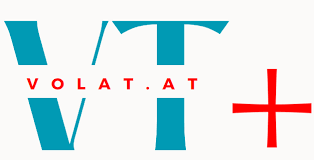[ad_1]
Viele Vereine in Österreich haben nur sehr wenige Mitglieder mit Migrationshintergrund. Ein Drittel hätte gerne mehr.
Wenn die Eltern von Mykola Bylik und Janko Božović nicht bereits Handballspieler gewesen wären, wer weiß, ob der in der Ukraine geborene Wiener und der gebürtige Montenegriner zu Leistungsträgern in der österreichischen Nationalmannschaft geworden wären, die die Handball-Europameisterschaft in Deutschland so überraschend rockte. In Österreich finden Menschen mit Migrationshintergrund relativ selten den Weg in Sportvereine außerhalb von Fußball und Kampfsport, wie eine große Umfrage der Neuen Österreichischen Organisationen zeigt.
&w=2048&q=100)
Beispielsweise ist bei West Vienna, dem amtierenden österreichischen Handballmeister, der sich nach dem erzwungenen Abstieg aus finanziellen Gründen nun mit einer jungen Mannschaft den Wiederaufstieg erkämpft, Bela der exotischste Spieler-Vorname unter drei Fabianern, zwei Clemens, einem Andreas, Philipp oder Paul. Im Jugendbereich ist es ähnlich. „Wir würden uns wirklich wünschen, mehr Spieler mit Migrationshintergrund zu haben“, sagt Lukas Musalek, der bei West Vienna für den Jugendbereich verantwortlich ist.
Der Wille ist da, aber es besteht auch der Bedarf an Unterstützung
Damit ist er nicht allein: Die österreichweite Befragung von mehr als 5.000 Sportvereinen ergab, dass zwei Drittel weniger als zehn Prozent Mitglieder mit Migrationshintergrund haben; Noch seltener sind Migrantentrainer. Umgekehrt gaben vier von fünf an, dass ihnen Diversität besonders wichtig sei, fast ein Drittel wünscht sich mehr Migranten als Mitglieder und ein Viertel wünscht sich mehr Migrantentrainer. Kein Wunder, denn Sport ist eines der besten Instrumente der Integration, von dem die Gesellschaft als Ganzes profitiert. Den Vereinen kommt hier eine gewisse Vorbildfunktion zu.
Allerdings gibt es in 85 Prozent der Vereine keinen Verantwortlichen für den Bereich Integration und Diversität und nur ein Zehntel verfügt über ein eigenes internes Integrationsprojekt. Es ist bekannt, welche wichtige Rolle der Sport bei der Integration spielt. Dino Schosche, Sprecher der Neuen Österreichischen Verbände, zieht folgendes Fazit: „Wir sehen einen großen Bedarf an Unterstützung und Weiterbildung sowie den Willen, die erfolgreiche Teilnahme aller Menschen in Sportvereinen zu fördern.“ Denn wie die Studie auch zeigt, sind Diversität und Integration zwar nur für rund ein Viertel der Wiener Sportvereine ein Thema, dennoch wünschen sich knapp 60 Prozent kostenlose E-Learning-Plattformen oder Workshops zum Thema.
Um diese externen Inhalte nutzen zu können, müssen Sie Tracking-Cookies zulassen.
Bei Ingo Bergmann sind Sie an der richtigen Adresse. Der 37-jährige Wiener aus Rostock ist seit mehreren Jahren gemeinsam mit seiner Frau Rosa im Sport- und Freizeitbereich im Hinblick auf gesellschaftliche Teilhabe aktiv. Sie gründete die Vienna Hobby Lobby, deren erklärtes Ziel als soziales Start-up kostenlose Freizeitaktivitäten für Kinder und Jugendliche aus sozioökonomisch benachteiligten Verhältnissen sind; Er war Mitbegründer der gemeinnützigen Organisation Breaking Grounds, deren Slogan „Sozialer Wandel durch Sport“ Programm ist. Bergmann und sein Team möchten ihre Expertise zu den Themen Inklusion, Kinderschutz, soziales Lernen, Gewaltprävention und Empowerment junger Menschen an andere weitergeben. Breaking Grounds unterstützte im vergangenen Jahr rund 2.400 junge Menschen und versteht sich als eine Art Kompetenzzentrum für Jugendarbeit über den Sport hinaus. Den Anfang machte das Projekt „Kicking without Limits“, das „die Kraft des Fußballs nutzt, um Kinder und Jugendliche bei der Entfaltung ihrer Potenziale zu unterstützen“, wie es auf der Website heißt. Später kam das Projekt „Life Goals“ hinzu, bei dem die Turnhalle zum Lern- und Entwicklungsraum wird.
Einfache Zugänglichkeit
Bergmann, der seit seinem 14. Lebensjahr Fußballtrainer ist und unter anderem in den Townships in Südafrika gearbeitet hat, nannte im Interview mit der WZ drei Hebel, mit denen man viel erreichen kann. Der erste ist die einfache Erreichbarkeit des Clubs: „Der Club muss möglichst barrierefrei sein“, betont er. Kinder und Jugendliche ohne österreichische Staatsbürgerschaft sind fast dreimal stärker von Armut oder Ausgrenzung bedroht als solche mit österreichischer Staatsbürgerschaft. „Für viele Menschen ist es viel schwieriger, einem Verein beizutreten, der Geld kostet.“ Deshalb ist beispielsweise das vom Sportministerium geförderte Projekt „Kicken ohne Grenzen“ kostenlos. Abgesehen davon ist Fußball äußerst zugänglich: Die Ausrüstung ist relativ günstig, die Regeln sind einfach und bekannt und man kann es fast überall spielen.
Zeitliche Ressourcen für die Beziehungsarbeit
Der zweite Hebel ist die Beziehungsarbeit: Es gilt, die Jugendlichen im Alltag, in ihren Problemsituationen auch außerhalb der Ausbildung mental zu unterstützen und ein Unterstützungssystem auf Augenhöhe zu schaffen. Dies erfordert zusätzliche Zeitressourcen. „Das ist natürlich viel verlangt“, sagt Bergmann. „Man muss ein paar Kilometer extra gehen.“ Aber manchmal sind es die kleinen Dinge, die den Unterschied machen: Zum Beispiel, wenn jemand nicht zum Training kommt und der Trainer fragt, was los ist. Das eine ist Talentförderung und Leistungsentwicklung, das andere Entwicklungsarbeit, Empowerment und psychosoziale Unterstützung.
Identität, Zugehörigkeit und Entwicklung
Als dritten Hebel nennt Bergmann Identitätsbildung und Zugehörigkeit. „Das ist vor allem bei jungen Menschen eine Sehnsucht. Sie wollen sich verstanden fühlen und ein Zuhause finden.“ Unterstützt wird dies durch partizipative Ansätze: Bei „Kicking without Borders“ finden sie Entwicklungsmöglichkeiten, sie können Verantwortung übernehmen, zum Beispiel in Form eines Jugendbeirats, und es gibt eigene „Youth Leaders“ als Vermittler :insider und Multiplikatoren:innen für die Jugend. „Das passiert alles neben dem Sport, außerhalb des eigentlichen Trainings“, sagt der Vereinsmitbegründer. Und wenn man dann auch noch geteilte Trikots oder Trainingsoutfits bekommt, steigert das das Zugehörigkeitsgefühl enorm. „Das ist auch für junge Leute sehr wichtig.“
Doch wie erreicht man die jungen Leute? Der beste Weg ist, dorthin zu gehen, wo sie sind, und sie aktiv anzugehen: zum Beispiel in Schulen und Jugendeinrichtungen. Es hilft, lokale Partnerorganisationen ins Boot zu holen, um die Zielgruppe zu erreichen. Vieles davon kommt durch Mundpropaganda, durch ermutigende Vertraute und durch Vorbilder. Je vielfältiger die bestehenden Teams und Supportteams sind, desto vielfältiger sind die potenziellen Mitglieder.
Gemeinsames Integrationsprojekt von ASKÖ, ASVÖ und Sportunion
Die großen Sportorganisationen sind nicht untätig. Seit Juli 2023 (bis Juni 2026) läuft das dreijährige Projekt „Beyond Sport 2.0“, bei dem ASKÖ, ASVÖ und Sportunion zusammenarbeiten und ihre Vereine speziell für Flüchtlinge sowie Kinder und Jugendliche aus armen Verhältnissen kostenlos öffnen -Einkommensfamilien und bieten eigene Kurse an. Im Vorgängerprojekt (2020 bis 2023) wurden mehr als 36.000 Teilnehmer verzeichnet.
Geringe Migrantenanteile seien nicht den betroffenen Vereinen anzulasten, betont Bergmann. „Es kommt auch auf die gesellschaftliche Gesamtsituation an.“ Manchmal können sie tatsächlich nichts dagegen tun. Wie West-Wien, wo Musalek berichtet, dass sie schon seit längerem auf Werbetour in den Schulen rund um seinen Standort gehen. Obwohl die älteren Jahrgänge und die Kampfmannschaft ihre Heimspiele im 15. Bezirk austragen, wo laut Statistik fast jeder zweite Einwohner im Ausland geboren wurde, findet das Training in Hietzing statt, dem Wiener Bezirk mit dem geringsten Migrantenanteil. „Wenn wir im 15. Bezirk ansässig wären, hätten wir sicherlich mehr Migranten“, ist Musalek überzeugt.
Insgesamt gibt es in Wien nur fünf Handballvereine für Jungen und Mädchen, die nicht alle Spiele in jeder Altersklasse anbieten (West-Wien hat beispielsweise nur Männermannschaften). „Dadurch gehen uns viele Potenziale verloren“, resümiert der junge Manager. Zudem gebe es in der Türkei und anderen starken Herkunftsländern keine starke Handballtradition, „die Kinder spielen eher Fußball oder machen Kampfsport.“ Auch wenn West-Wien sich ausdrücklich der Diversität verschrieben hat, werden es wohl weiterhin überwiegend Österreicher sein, die grüne Kleider mit der Aufschrift „#DIVERSITY“ tragen.
[ad_2]