[ad_1]
In den neuen Folgen unseres Podcasts werden wir ganz persönlich und sprechen mit Menschen aus unterschiedlichen Lebensbereichen darüber, was sie bewegt, was sie im Leben glücklich macht, was sie beunruhigt und welche Wendepunkte sie bisher erlebt haben. In dieser Folge geht es um die 20-jährige Marie. Seit ihrem elften Lebensjahr litt sie während der gesamten Pubertät an Depressionen. Es war die Geisteskrankheit ihrer Mutter, die sie sehr belastete und in eine Krise stürzte. Heute ist Marie wieder eingelebt: Sie macht eine Apothekerlehre, findet ihren Ausgleich im Taekwondo und lebt mit ihrem Partner und dem Hund Scotty in einer eigenen Mietwohnung. Dies spielte eine wichtige Rolle auf ihrem Weg aus der Depression. Was das war, verrät Marie in dieser Folge unseres WZ-Podcasts den Moderatoren Petra Tempfer und Mathias Ziegler.
Hilfe bei Lebenskrisen
Sie befinden sich in einer verzweifelten Lebenssituation und benötigen Hilfe? Sprechen Sie mit anderen Menschen darüber.
Produziert von „Hören hören!“.
Ihnen hat dieser Artikel besonders gut gefallen oder Sie haben Tipps für uns – teilen Sie uns Ihre Meinung unter feedback@wienerzeitung.at mit. Möchten Sie uns helfen, unser gesamtes Produkt zu verbessern? Dann registrieren Sie sich hier.
Informationen und Quellen
Genesis
Ursprünglich wollten wir mit der 20-jährigen Marie eine Podcast-Folge über das Leben als Lehrling machen. Doch dann nahm das Ganze eine unerwartete Wendung, als sie im Vorgespräch sagte, sie leide seit Jahren an Depressionen. . .
Gesprächspartner
Marie ist 20 Jahre alt und macht eine Ausbildung zur pharmazeutisch-kaufmännischen Assistentin in einer Apotheke. Sie hat drei viel jüngere Geschwister und ist von Niederösterreich nach Wien gezogen, wo sie mit ihrem Partner und dem Hund Scotty in einer Mietwohnung lebt. In ihrer Freizeit hilft ihr vor allem Taekwondo, sich zu erden.
Daten und Fakten
-
Die Österreichische Krankenversicherung (ÖGK) stellt jährlich ein Kontingent von 1,175 Millionen vollfinanzierten Psychotherapiestunden zur Verfügung. Das ist eine Steigerung um 300.000 Stunden im Vergleich zum Jahr 2018 (also vor Corona). Nach Berechnungen des Österreichischen Bundesverbandes für Psychotherapie reicht diese Quote jedoch nur für 70.000 Patienten, also rund ein Prozent der 7,3 Millionen Versicherten. Schätzungen gehen jedoch davon aus, dass rund fünf Prozent der Bevölkerung Kriterien für eine Depression aufweisen. Rund zehn Prozent der Österreicher nehmen Psychopharmaka. Die durchschnittliche Dauer einer psychotherapeutischen Behandlung einer depressiven Erkrankung kann mit 30 bis 50 Stunden angenommen werden.
-
Die durchschnittliche Behandlungsstunde in den Bundesländern wird von der Krankenkasse mit 85 Euro erstattet. Nach einer Berechnung der Arbeiterkammer müssten es 119 Euro pro Stunde sein, um eine Praxis finanzieren oder einen Psychotherapeuten entsprechend im Tarifvertrag bezahlen zu können.
-
Die Tarife für private Psychotherapie liegen zwischen 120 und 150 Euro pro Stunde, davon werden 33,70 Euro von der ÖGK erstattet. Und ab der elften Behandlung benötigen Sie eine chefärztliche Genehmigung.
-
Derzeit sind 11.966 Psychotherapeuten in der Berufsliste des Gesundheitsministeriums eingetragen. Weitere rund 2.500 Psychotherapeuten in der Ausbildung unter Supervision haben Anspruch auf eine Behandlung, können diese aber noch nicht mit der Krankenkasse abrechnen.
-
Psychische Erkrankungen wie Depressionen stellen nicht nur eine Belastung für die Betroffenen dar, sondern stellen auch die gesamte Wirtschaft vor große Herausforderungen. Der Österreichische Gewerkschaftsbund (ÖGB) verweist in diesem Zusammenhang auf den kürzlich veröffentlichten Abwesenheitsbericht, wonach der Anteil der Krankenstände aufgrund psychischer Erkrankungen stetig zunimmt (zehn Prozent aller Krankenstände sind inzwischen darauf zurückzuführen) und diese Besonders lange dauern: Während ein Krankenstand durchschnittlich 9,3 Tage dauert, liegt die durchschnittliche Dauer bei psychischen Erkrankungen bei 37,2 Tagen. Davon sind auch Auszubildende und junge Erwachsene im Berufsleben betroffen. Auch der Anteil der Menschen, die dauerhaft arbeitsunfähig sind, ist besorgniserregend hoch. Zuletzt hatten 33,7 Prozent der Neuankömmlinge in der Berufsunfähigkeits- und Invalidenrente eine psychische Erkrankung, bei den Frauen waren es sogar 44,2 Prozent. Bei den Reha-Geldern lag die Summe bei 43,6 Prozent (Frauen: 46,8 Prozent). Damit ist der mit Abstand größte Anteil dauerhafter oder vorübergehender Arbeitsunfähigkeit auf psychische Erkrankungen zurückzuführen.
Quellen
Das Thema in der WZ
Das Thema in anderen Medien
[ad_2]
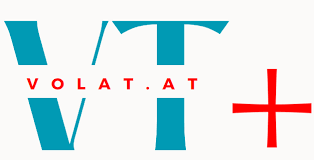

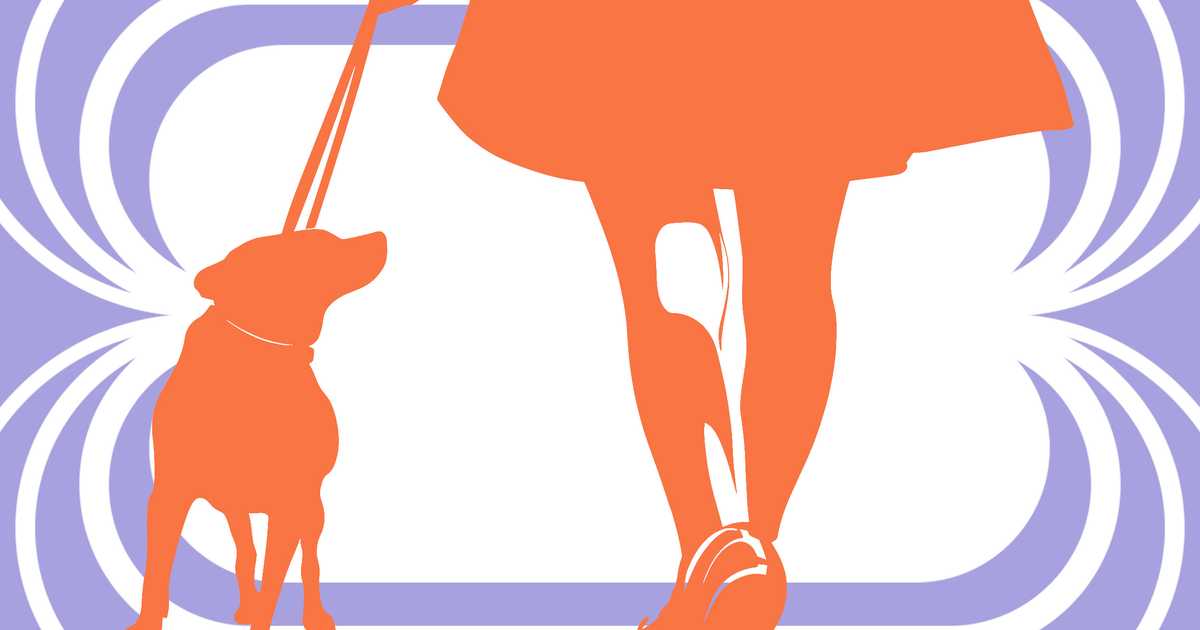
)
)